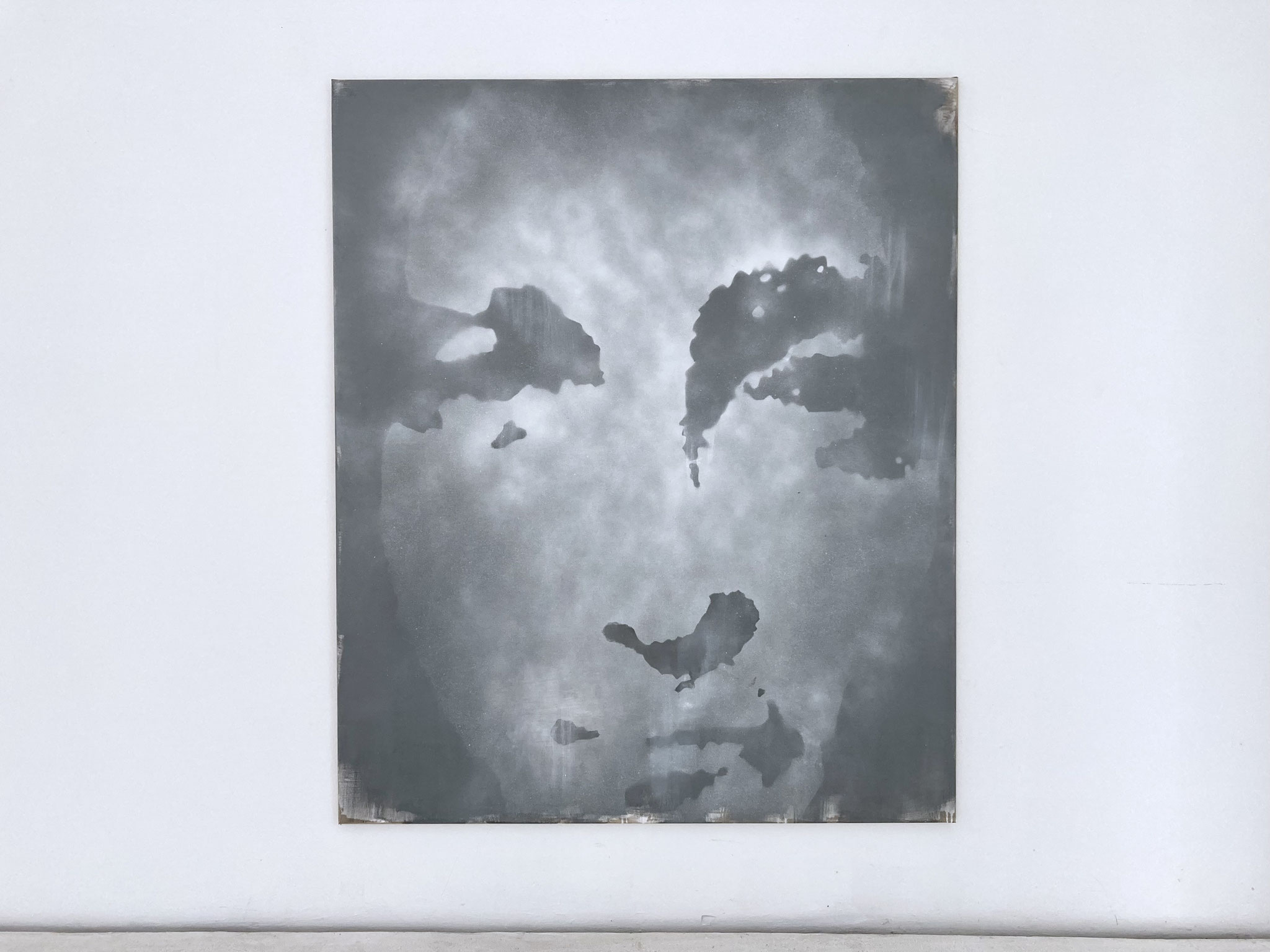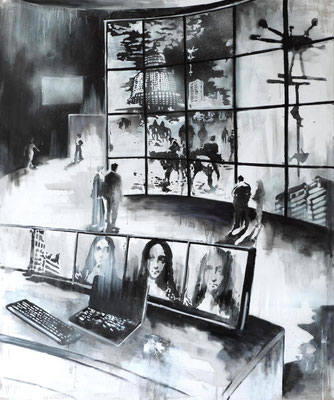C U R R E N T
HANS PETER STARK
Szenen zu Leonardos Salvator Mundi 2022/25
paintings
20/09 - 31/10/2025
Opening Reception: Saturday, 20 September 2025, from 11 am - 8 pm
Hans-Peter Stark zitiert in monumentalen Triptycha das ikonische Motiv des Salvator Mundi von Leonardo da Vinci. Sowohl das Triptychon als auch der Salvator Mundi verweisen auf die Trinität und
bilden für HP Stark den thematischen Rahmen seiner zeitgenössischen narrativen Szenen. Im ersten Triptychon erscheint Christus mehrfach, jeweils vergrößert auf jeder Bildtafel; im zweiten steht
Leonardos Salvator Mundi im Zentrum und wird von aktuellen Szenen umgeben, die gesellschaftliche Themen wie Überwachung, urbane Transformation und digitale Medien aufgreifen. HP Stark arbeitet
mit zeichenhafter, dynamischer Linienführung und betont symbolhafte Elemente, wodurch die Spannung zwischen historischen und gegenwärtigen Bildwelten hervorgehoben wird.
Seit dem Mittelalter prägt das Triptychon die religiöse Kunst und wurde von Künstlern wie Francis Bacon, Ai Weiwei und Damien Hirst genutzt, um gesellschaftliche Umbrüche zu reflektieren.
Leonardos Salvator Mundi setzte innovative Maßstäbe in Lichtführung und Symbolik: Die Kristallkugel verweist auf Reinheit, göttliche Gegenwart, Wissenschaft und Transzendenz. Martin Kemp
beschreibt das Werk als von „uncanny strangeness“ und einer Präsenz geprägt, die über das Sichtbare hinausweist: 'It is the ultimate painting. It is the Mona Lisa experience – you feel a
presence, a sense of enigma, as if she is more than a painting.'
Hans Peter Stark greift diese Impulse auf und eröffnet einen Dialog zwischen Renaissance, Wissenschaft und Gegenwart.

Studies on Leonardo's Salvator Mundi, triptych II, 2025
English
Hans-Peter Stark cites the iconic motif of Leonardo da Vinci’s Salvator Mundi in monumental triptychs. Both the triptych format and the Salvator Mundi allude to the Trinity, providing Stark with the thematic framework for his contemporary narrative scenes. In the first triptych, Christ appears repeatedly, enlarged on each panel; in the second, Leonardo’s Salvator Mundi takes center stage, surrounded by contemporary scenes addressing social issues such as surveillance, urban transformation, and digital media. Stark works with a distinctive, dynamic line and emphasizes symbolic elements, heightening the tension between historical and contemporary visual worlds.
Since the Middle Ages, the triptych has shaped religious art and was later used by artists such as Francis Bacon, Ai Weiwei, and Damien Hirst to reflect moments of societal upheaval. Leonardo’s Salvator Mundi set innovative standards in the treatment of light and symbolism: the crystal orb refers to purity, divine presence, science, and transcendence. Martin Kemp describes the work as marked by an “uncanny strangeness” and a sense of presence that points beyond the visible: “It is the ultimate painting. It is the Mona Lisa experience – you feel a presence, a sense of enigma, as if she is more than a painting.”
Hans-Peter Stark takes up these impulses, opening a dialogue between Renaissance, science, and the present day.
SZENEN ZU LEONARDOS SALVATOR MUNDI, 2022/25, triptych I + II, acrylic, spray paint, oil on canvas, each 180 x 150 cm
HANS PETER STARK
20.09. - 31.10.2025
Szenen zu Leonardo's Salvator Mundi
2022 - 2025
2 Triptychen, 6 Einzelbilder, jeweils 180 × 150 cm
Öl, Acryl, Sprühlack auf Leinwand
Der Salvator-Zyklus von Hans Peter Stark präsentiert eine zeitgenössische Auseinandersetzung mit dem
ikonischen Motiv des Salvator Mundi – dem Weltenretter – und entwickelt daraus einen
gesellschaftskritischen Diskurs über Erlösung, Kontrolle und Identität im 21. Jahrhundert. Die sechs
großformatigen Arbeiten, angelegt als zwei Triptycha, greifen bewusst die Tradition religiöser Altartafeln auf,
um diese in einen urbanen, multiperspektivischen Kontext zu transformieren.
Die Kompositionen variieren zwischen strenger fotorealistischer Figuration und grafisch-abstrahierten
Fragmentierungen. Im Zentrum der Serie steht die Christusfigur, die sich mit erhobener Segenshand und
charakteristischer Glaskugel als zentrales Symbol für Hoffnung, göttliche Ordnung und die Ambivalenz der
heutigen Existenz manifestiert. Die abgestimmte monochrome Farbpalette, die starken Hell-Dunkel-
Kontraste sowie das Zusammenspiel von Sprühlack und Acryl verleihen den Oberflächen eine rohe,
fragmentierte und zugleich urbane Ästhetik. So entsteht eine ikonische Präsenz, die zwischen sakraler
Würde und profaner Alltäglichkeit oszilliert.
Das erste Triptychon erzeugt eine komplexe modulare Bildarchitektur: Die Kombination eines gigantischen
Screens mit vielfachen Bildrahmenstrukturen verweist formal und inhaltlich auf die ikonografische
Fragmentierung und Rasterung, die für Gilbert & George prägend ist. Diese gestalterische Strategie evoziert
eine Monumentalität, die an sakrale Glasmalstrukturen und die mediale Inszenierung von Räumen erinnert,
vergleichbar mit der raumgreifenden Bildsprache in Les Levines Media Cage. Thematisch schlagen die
apokalyptischen und utopischen Assoziationen durch Reitergruppen, Turmbauten und urbane Landschaften
eine Brücke zur globalisierten Mediengesellschaft und zur kollektiven Beobachtung.
Das zweite Triptychon konzentriert sich auf die frontal gehaltene Christusfigur, die in der dritten Tafel – dem
am höchsten vergrößerten Porträt – trotz einer vorherrschenden Graupalette eine silbergraue, schimmernde
Wirkung entfaltet, die an Andy Warhols Diamond Dust Portraits erinnert. Die Bildfolge thematisiert die
Spannung zwischen Erlösung, Kontrolle und medialer Sichtbarkeit.
Kontrastierend zu dieser ästhetisch helleren Serie sind die narrativen Szenen des ersten Triptychons
geprägt von Überwachung, Kontrolle und der Fragilität menschlicher Autonomie, symbolisiert durch die
Kugel, die nicht nur die Welt repräsentiert, sondern auch als Zeichen für Überwachungsmechanismen und
gesellschaftliche Zerbrechlichkeit gelesen werden kann.
Hans Peter Stark stand für diesen Zyklus im Austausch mit dem renommierten Leonardo-Experten Martin
Kemp. Auf die Frage, ob Leonardo da Vinci gläubig gewesen sei, bestätigte Kemp dies klar und unterstrich
Leonardos „Salvator Mundi“ als eine einzigartige religiöse Ikone – eine Art spirituelle Mona Lisa – mit
tiefgründiger Verbindung zwischen Wissenschaft und Glauben: „It’s the crystalline sphere of the heavens.
It's the outermost reach of the universe. There's nothing beyond that other than heaven, which we can't
really know.“ (Kemp, 2018)
Vor dem Hintergrund globaler Krisen, digitaler Überwachung und gesellschaftlicher Unsicherheiten eröffnet
Hans Peter Starks Zyklus einen vielschichtigen Dialog zwischen klassischer Ikonografie und moderner
Medienwelt. Er reflektiert die ambivalente Rolle von Erlösung, Kontrolle und Hoffnung in einer
verunsicherten Gegenwart und fordert dazu auf, Identität und gesellschaftliche Beobachtung kritisch zu
hinterfragen. Dabei macht der Zyklus auch die Spannungen des Kunstmarkts und die unterschiedlichen
Bedeutungszuschreibungen eines Kunstwerks im postmortalen Lebenszyklus sichtbar.
English
HANS PETER STARK
20.09. - 31.10.2025
Szenen zu Leonardos Salvator Mundi
2022 - 2025
2 triptychs, 6 single canvases
each 180 × 150 cm, oil, acrylic, spray on canvas
Hans Peter Stark’s Salvator cycle offers a contemporary engagement with the iconic Salvator Mundi motif –
the Savior of the World – developing a critical discourse on salvation, control, and identity in the 21st
century. The six large-scale works, arranged as two triptychs, deliberately reference the tradition of religious
altarpieces, transforming it into an urban, multiperspective context.
The compositions range between strict photorealism and graphic abstraction. Central to the series is the
figure of Christ, manifesting with raised blessing hand and characteristic orb as a symbol of hope, divine
order, and the ambivalence of contemporary existence. The monochrome palette, strong chiaroscuro, and
interplay of spray enamel and acrylic give the surfaces a raw, fragmented, yet urban aesthetic, creating an
iconic presence oscillating between sacred dignity and profane everyday life.
The first triptych creates a complex modular visual architecture: the combination of a gigantic screen with
multiple picture frame structures recalls formally and conceptually the iconic fragmentation and gridding
characteristic of Gilbert & George. This design strategy evokes a monumentality reminiscent of sacred
stained-glass installations and the medial staging of space, comparable to the immersive imagery in Les
Levine’s Media Cage. The apocalyptic and utopian associations evoked by horsemen, towers, and urban
landscapes bridge to the globalized media society and collective surveillance.
The second triptych focuses on the frontal portrayal of Christ, with the third panel – the most enlarged
portrait – revealing a silvery, shimmering effect despite a prevailing gray palette, reminiscent of Andy
Warhol’s Diamond Dust Portraits. The sequence explores the tension between salvation, control, and media
visibility.
In contrast to this luminescent aesthetic, the narrative scenes of the first triptych are marked by
surveillance, control, and the fragility of human autonomy – symbolized by the orb, which represents not
only the world but also serves as a sign of surveillance mechanisms and societal vulnerability.
Hans Peter Stark corresponded with renowned Leonardo expert Martin Kemp for this cycle. Asked whether
Leonardo da Vinci was religious, Kemp responded affirmatively and highlighted Leonardo’s “Salvator
Mundi” as a unique religious icon – a sort of spiritual Mona Lisa – with a profound connection between
science and faith: “It’s the crystalline sphere of the heavens. It's the outermost reach of the universe.
There's nothing beyond that other than heaven, which we can't really know.” (Kemp, 2018)
Against the backdrop of global crises, digital surveillance, and societal uncertainty, Stark’s cycle opens a
layered dialogue between classical iconography and the contemporary media world. It reflects the
ambivalent roles of salvation, control, and hope in an unsettled present, inviting critical reflection on identity
and societal observation. The cycle also makes visible the tensions of the art market and the shifting
attributions of meaning in the posthumous life of an artwork.
B R I G I T T E M A R C H S T U T T G A R T